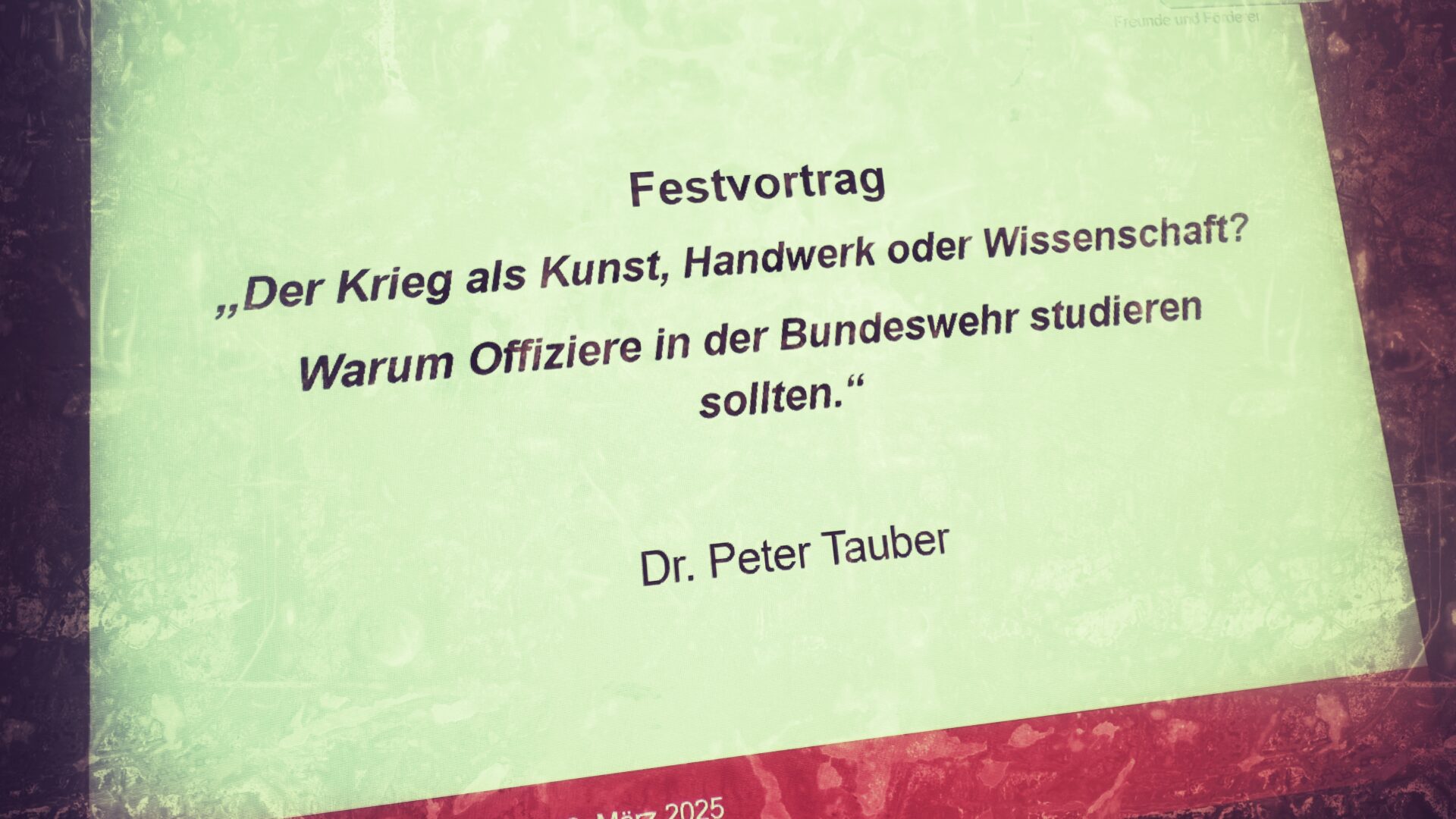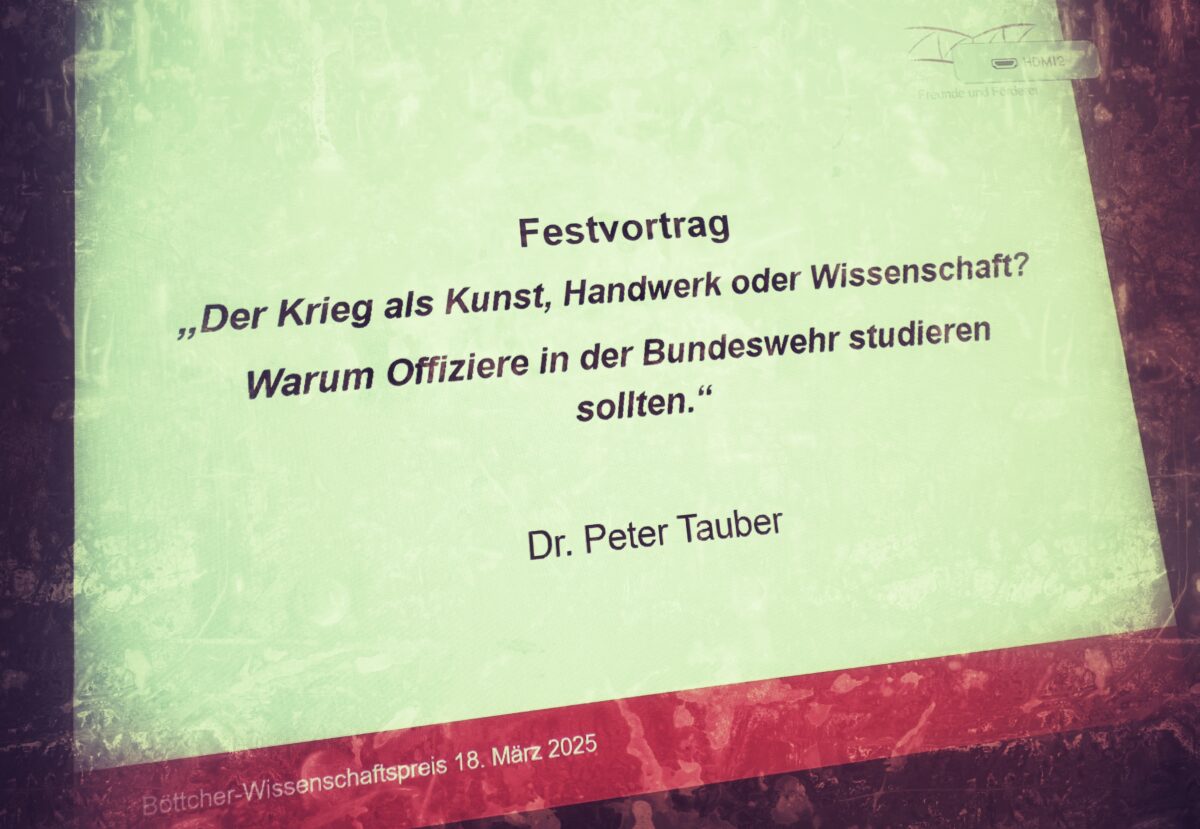Der Krieg als Kunst, Handwerk oder Wissenschaft?
Warum Offiziere in der Bundeswehr studieren sollten.
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier anlässlich der Verleihung des Wissenschaftspreises der Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität sprechen zu dürfen.
Moltke hat zwar gesagt: „Ich habe Antipathie gegen Lobhudeleien. Es macht mich für einen ganzen Tag verstimmt, so etwas zu hören.“
Aber wenn man das so sieht, dann sollte man nicht zu einer Preisverleihung gehen. Widersprechen wir Moltke also ausnahmsweise einmal.
Mit hanseatischer Klarheit ist die wissenschaftliche Leistung von Dr. Nina Brandau gewürdigt worden. Das wiederum hätte Moltke gefallen, der eben auch formuliert hat: „Wenn man eine ruhmvolle Tat zu erzählen hat, so braucht man nicht zu sagen, dass sie ruhmvoll gewesen ist. Die einfache Darstellung des Verlaufs enthält das Lob.“
Den Glückwünschen zur wissenschaftlichen Leistung von Dr. Nina Brandau darf ich mich deshalb anschließen.
Dass an einer Universität, die der wissenschaftlichen Ausbildung von Offizieren dient, ein solcher Preis verliehen wird, wirft aber zugleich Fragen auf. Fragen, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven gestellt werden können. Warum lässt die Bundeswehr ihre jungen Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter, ihre jungen Offiziere studieren?
Eine offizielle Antwort lautet: Damit diese als Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten nach dem Ende ihrer Dienstzeit und dem Ausscheiden aus den Streitkräften auf dem zivilen Arbeitsmarkt bessere Chancen haben.
Wenn es um die Attraktivität des Soldatenberufs geht, wenn junge Abiturientinnen und Abiturienten angesprochen werden, dann ist das bis heute ein sehr oft zu hörendes Argument.
Es ist aber ein oberflächliches Argument. Wenn es nicht weitere Gründe gebe, dann wäre es aus Sicht der Streitkräfte nicht klug, die jungen Soldatinnen und Soldaten studieren zu lassen. Dann würde man das Studium an das Ende der Dienstzeit legen, um davon zu profitieren, dass die jungen Menschen voller Tatendrang und Kraft sich zunächst ganz dem Soldatenhandwerk widmen und Erfüllung im Leben in der militärischen Gemeinschaft finden.
Aber offensichtlich verspricht man sich etwas davon, dass junge Offiziere erst nach dem Studium in größerem Umfang Führungsaufgaben wahrnehmen. Warum ist das so?
Offiziere als gebildete Menschen
Könnte es daran liegen, dass das Studium der Idee folgt, dass ein Offizier mehr ist als ein Vorgesetzter mit militärischem Sachverstand?
Auch wenn schon vor der Gründung der Universität der Bundeswehr die Notwendigkeit einer akademischen Ausbildung von Offizieren auf der Grundlage der speziellen Bedürfnisse der Bundeswehr immer klarer hervortrat, spricht doch vieles dafür, dass auch übergeordnete Überlegungen eine Rolle spielten und nicht nur der praktische Mehrwert eines aufgrund der zunehmenden Technologisierung entsprechend studierten Offiziers den Ausschlag gab, dieselben studieren zu lassen.
Das ist bemerkenswert bleibt doch der Kern des Offizierberufs ein anderer: Die Menschenführung. Und so gesehen gibt es nur ein Studienfach, dass hierfür geeignet ist und komischerweise bisweilen hinter vorgehaltener Hand belächelt wird: die Pädagogik.
Die Notwendigkeit des Offizierberufs und ihre Daseinsberechtigung leiten Offiziere daraus ab, dass sie Menschen führen. Um diese Fähigkeit zu erwerben, scheint mir einem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, der Erwerb hoher Ingenieurskunst oder auch das Durchdringen der Staats- und Sozialwissenschaften nicht zwingend hilfreich und erst recht nicht notwendig.
Es geht also offensichtlich um etwas anderes: Das Studium, so die Annahme, vermittelt Offizieren neben dem jeweiligen Fachwissen Kompetenzen in der Organisation und der Zusammenarbeit, es fördert kritisches Denken, gibt Raum für die persönliche Entwicklung und stärkt analytische Fähigkeiten sowie die Forschungskompetenz. All das sind wesentliche Elemente wissenschaftlichen Arbeitens.
Moltke hat aber nun gesagt:„Kriegsführen ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst.“
Erneut müssen wir Moltke widersprechen.
Er selbst gehörte ja außerdem zu denen, die den Krieg selbst im preußischen Generalstab und auf der Kriegsakademie wissenschaftlich durchdacht haben.
Wir sind also der Überzeugung, dass der wissenschaftlich gebildete Offizier seinen vielfältigen Aufgaben besser gerecht werden kann. Aber ist das überhaupt so: Sind die Aufgaben des Offiziers so vielfältig?
„Allem wozu Streitkräfte gebraucht werden, liegt die Idee des Gefechts zugrunde. Sonst würde man ja keine Streitkräfte gebrauchen.“ hat Clausewitz gesagt. Ist das ein provokanter Gedanke?
Dieser so schlichte wie wahre Satz führt uns auf das zurück, wofür wir angehende Offiziere studieren lassen: Um im Gefecht ihre Truppe erfolgreich zu führen und siegreich zu bestehen.
Wenn wir nicht der Überzeugung wären, dass der gebildete und studierte Offizier prinzipiell dieser Aufgabe besser gerecht wird, dann wäre die Universität wirklich nicht mehr als ein Attraktivitätsfaktor und übrigens auch eine teure Veranstaltung.
Noch einmal: Dann wäre es zweckmäßiger, den ausscheidenden Offizieren ein ziviles Studium zu finanzieren und bei den Offizieren, die Berufssoldaten werden ganz auf ein Studium zu verzichten. Und es ist ja bemerkenswert: Ich kenne niemanden, der das ernsthaft so sieht.
Die einzige Ausnahme mag der ein oder andere junge Mensch sein, interessanterweise sind es nach meiner Beobachtung nur Männer, die während des Studiums auch habituell zum Ausdruck bringen, dass sie oder er als „geborene Kriegsgötter“ doch an der Universität eigentlich fehl am Platze wähnen.
Ob die damit manchmal einhergehende Studienleistung auf mangelnden Intellekt oder mangelnde Haltung in der Pflicht zurückzuführen ist, kann hier nicht bewertet werden. Offenkundig ist aber, dass bei allen unterschiedlichen Anlagen, die wir Menschen mitbringen, hier doch ein Denkfehler vorliegt und die lebensjungen Kameraden ihren Clausewitz nicht verstanden haben.
Aus dem genannten Zitat abgeleitet ergibt sich zwingend, dass nicht nur ein gut ausgebildeter, sondern nur ein umfangreich gebildeter Offizier den Ansprüchen, die der Dienst an ihn oder sie stellt, gerecht werden kann.
Wir reden von Bildung und nicht Ausbildung
Der Krieg ist also keine Kunst, die ja trotz allen Übens vor allem eine Sache des Talents ist. Der Krieg ist auch nicht Handwerk, das man allein durch eine Ausbildung erlernen kann. Der Krieg ist vielmehr eine Wissenschaft, die es zu durchdringen, zu verstehen gilt. Und das setzt eins voraus: Bildung.
Bildung allerdings in einem heute durch Rationalisierung und Reformen nahezu unkenntlich gemachten Verständnis im Sinne Humboldts: Als Bildung des Herzens und des Charakters.
Folgte die Entscheidung Helmut Schmidts, Universitäten zu gründen, um junge Soldaten auf dem Weg zum Offizier studieren zu lassen, doch eher Clausewitz und nicht den Idealen der Bildungsreformen der 1960er Jahre?
Clausewitz hat nämlich auch gesagt: „Militärisches Führertum beruht nicht auf rationalem Kalkül, spezialisiertem Fachwissen und technischer Routine, sondern auf hoher Geistigkeit, vereint mit Charakter und Seelenstärke.“
Das verweist darauf, dass diejenigen, die als Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter in die Streitkräfte eintreten, sich nicht für einen Beruf wie jeden anderen entschieden haben.
Der Beruf des Offiziers ist ein Beruf sui generis. Das ergibt sich auch daraus, dass die Bundeswehr eben kein Unternehmen ist, auch wenn die Werbung manchmal anderes suggeriert.
Es kann sein, dass man an den Universitäten der Bundeswehr sowohl Lehrpersonal als auch Studentinnen und Studenten manchmal daran erinnern muss, dass Sie bei aller Augenhöhe mit „zivilen“ Universitäten in der wissenschaftlichen Qualität eben doch aus einem ganz anderen Grund studieren: Um Offiziere zu werden, um Menschen zu führen, um im Zweifel Frieden und Freiheit tapfer zu verteidigen.
Doch woher stammt die Idee, nicht nur das Waffenhandwerk beherrschen zu müssen, sondern die Notwendigkeit zu sehen, über den Krieg und alle damit verbundenen Fragen nachzudenkennachdenken zu können und sie zu durchdringen?
Den Krieg denken und verstehen: Die Verwissenschaftlichung des Offizierkorps
Es kommt nicht von ungefähr, dass die meisten historischen Persönlichkeiten, die in der Bundeswehr traditionswürdig sind, militärische Denker sind: Clausewitz, Scharnhorst, Gneisenau, Moltke, von Hammerstein-Equord und vielleicht noch Seeckt. Hinzu treten die Väter der Inneren Führung: Heusinger, von Baudissin, Karst.
Die Offiziere des 20. Juli 1944 werden für ihre Haltung und ihren Charakter geehrt und aufgrund ihrer Opferbereitschaft für die übergeordneten Ideen von Recht und Freiheit, auf die auch die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vereidigt werden.
Rommel ist der einzige Soldat in der Traditionspflege der Bundeswehr, der für den Kern des Soldatenberufs als traditionswürdig gilt: Die Fähigkeit, im Kampf zu bestehen. Und selbst Rommel hat sich zunächst als Autor einen Namen gemacht und war eben nicht nur Truppenführer, die neuste Forschung weist zudem seine Verbindungen zum Widerstand des 20. Juli 1944 nach.
Wir haben also wenig Vorbilder die nicht lange überlegen, sondern direkt handeln. „Deutsche Krieger“, wie es Sönke Neitzel formuliert hat.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Generalinspekteur auffallend oft Captain America zitiert und als Vorbild nennt.
Und stimmt das überhaupt: Ist die Fähigkeit zum Kampf der wesentliche Kern des Soldatenberufs? Oder gibt es hier vielleicht einen Unterschied zwischen dem Gefreiten und dem General? Mir scheint das zumindest mit Blick auf die deutsche Militärgeschichte eine fast rhetorische Frage.
Machen wir uns klar: Spätestens mit der Verbürgerlichung des Offizierkorps veränderte sich auch der Bildungsanspruch an den Offizier. Dem Bildungsbürgertum entsprach der gebildete Offizier und erst recht der Reserveoffizier aus bürgerlichen Kreisen. Das Klischee des Offiziers, der als einzige Bücher nur die Bibel und das preußische Exerzierreglement las, war und ist bis heute eben genau das: ein Klischee.
Nach der Niederlage gegen Napoleon folgten die Reformen in den Jahren von 1807 bis 1815. Die Offizierbildung wurde neu gestaltet. Dies führte zur Schaffung einer systematischen Ausbildung der Offizier und der Gründung von Militärakademien.
1810 war die Preußische Kriegsakademie in Berlin gegründet worden, die eine zentrale Rolle in der Ausbildung der Offiziere spielte. Diese Akademie konzentrierte sich auf die Ausbildung des Offiziersnachwuchses und die Entwicklung militärischer Theorie.
Mit den Reformen gingen oft neue Lehrmethoden und Inhalte einher. Mit den Reformen wurde die Ausbildung umfangreicher und umfasste auch wissenschaftliche Disziplinen sowie militärische Theorien.
Zu nennen ist hier auch das Reformgesetz von 1860: Dieses Gesetz führte zu einer weiteren Professionalisierung der Armee und verbesserte die Ausbildung und den Werdegang von Offizieren, einschließlich klarerer Regelungen für die Beförderung.
Im Zuge der Industrialisierung geriet auch die technische Ausbildung und das Ingenieurswesen immer mehr in den Fokus und wurde fester Bestandteil der Bildung bei Offizieren. Es waren vor allem junge Männer aus bürgerlichen Familien, die sich den modernen Waffengattungen zuwandten, während Söhne aus adligen Familien in den Garden oder der Kavallerie dienten.
Was uns zu der Frage führt: Welche Offiziere gibt es?
Wir können es uns leicht machen und Kurt von Hammerstein-Equord, von 1930 bis 1933 Chef der Heeresleitung, erklärter Gegner Hitlers, zitieren:
„Ich unterscheide vier Arten. Es gibt kluge, fleißige, dumme und faule Offiziere. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die nächsten sind dumm und faul; sie machen in jeder Armee 90 % aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Hüten muss man sich vor dem, der gleichzeitig dumm und fleißig ist; dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten. Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Wer klug ist und gleichzeitig faul, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit.“
Man munkelt, dass es Studentinnen und Studenten an den Universitäten der Bundeswehr gibt, die eine gewissen Perfektion darin entwickeln, mit möglichst geringem Aufwand die bestmögliche Note im Studium zu erlangen. Sind das diejenigen, die Hammerstein als qualifiziert für „höchste Führungsaufgaben“ sieht?
Die Verachtung des gebildeten Offiziers
Es muss einmal gesagt werden: Es gibt eine ungute Tradition, die den gebildeten Offizier verächtlich macht. Auch deshalb habe ich mich so energisch gegen das Bild gewendet, der Offiziersberuf beruhe auf Handwerk oder künstlerischer Gabe. Er ist in seinem Wesen ein Beruf, der einer wissenschaftlichen Grundlage bedarf, wissenschaftliche Kompetenzen braucht, um ihm in seiner Komplexität gerecht zu werden.
Den Film „Der Untergang“ haben die allermeisten gesehen. Es gibt eine zentrale Szene gegen Ende des Films. Hitler wird gemeldet, dass Steiner nicht wie befohlen angegriffen hat. Hitler – von Bruno Ganz genial gespielt – rastet komplett aus, wenn man es so salopp sagen darf: „Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger treuloser Feiglinge. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. (…) Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Kriegsakademien zugebracht haben, nur um zu lernen wie man Messer und Gabel hält. (…) Ich hätte gut daran getan, vor Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. (…) Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein auf mich gestellt ganz Europa erobert.“
Hitler, der sich selbst als Genie sah – was eine Ausbildung und Bildung bekanntlich obsolet macht – äußert sich nicht erst im April 1945. Seine ablehnende Haltung gegenüber den gebildeten Offizieren der Reichswehr ist Legende.
Darum müssen wir widersprechen, wenn heute Soldaten und vor allem Offiziere zu Handwerkern des Krieges erklärt werden. Wir wollen eben keine Kriegsgötter oder gar Söldner, sondern den „Miles Protector“ oder auch den „Peacekeeper mit Gewaltanwendungspotential“. Und ist das Studium ein Baustein, um dieses Ziel zu erreichen?
Welche Offiziere wollen wir?
Aber stellen wir uns noch einmal ernsthaft die Frage, was wir uns erhoffen von einem akademisch gebildeten Offizier?
Neben der wissenschaftlichen Qualifikation steht vor allem die Idee der Persönlichkeitsbildung verbunden mit einem hohen Verantwortungsethos – für die eigene Person und auch für die Menschen, die ein Offizier führt. Dies scheint heute wichtiger denn je, denn unsere Gesellschaft ist vielfältiger, diverser, bunter als je zuvor. Und das stellt an den Offizier sicher höhere Anforderungen in der Führung von Menschen.
Der ehemalige Generalinspekteur Zorn hat einmal darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied mache, als Oberleutnant einen Zug Wehrpflichtiger zu führen oder einen Zug, in dem vom Familienvater über den Einsatzveteranen bis hin zum Schulabsolventen, Männer und Frauen, Menschen unterschiedlichster Herkunft und sexueller Orientierung zusammenkommen. Die Individualität ist in unserer freien Gesellschaft ein hohes Gut und dennoch oder gerade deshalb muss ein Offizier eine militärische Gemeinschaft prägen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe. Die Notwendigkeit von Zusammenhalt, den wir so oft in der Gesellschaft beschwören, ist hier überlebenswichtig.
„Kollektivismus ist ebenso asiatisch-russisch wie die Persönlichkeit europäisch-preußisch ist.“ hat Wolf Graf von Baudissin gesagt.
Hinzu kommt ein Staatsverständnis, dass von Offizieren verlangt, aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Deutsche Offiziere sind nicht auf eine Person oder die Nation verpflichtet, sondern auf die staatliche Ordnung, die sich das deutsche Volk nach 1945 gewählt hat.
Generaloberst Ludwig Beck brachte diese Verantwortung, die man ohne Kant und die protestantische Ethik nur schwer verstehen kann, auf den Punkt: „Es ist ein Mangel an Größe und an Erkenntnis der Aufgabe, wenn ein Soldat in höchster Stellung in solchen Zeiten seine Pflichten und Aufgaben nur in dem begrenzten Rahmen seiner militärischen Aufträge sieht, ohne sich der höchsten Verantwortung vor dem gesamten Volke bewußt zu werden.“
Generalmajor Andreas Hannemann hat einmal gesagt: „Ich brauche keine Piloten. Ich brauche Offiziere, die fliegen können. Ich brauch keine Ingenieure. Ich brauche Offiziere, die Brücken bauen können.“
In welche Bundeswehr treten heute studierte Offiziere ein?
„Der Moment ist für den Eintritt günstig. Das durch die Armeereorganisation sehr beträchtlich gesteigerte Bedürfnis an jungen Offizieren erleichtert die Annahme auch von Ausländern, und die Anforderungen an wissenschaftlicher Bildung oder wenigstens die Beurteilung der Leistung ist augenblicklich herabgesetzt.“
So hat es der junge Moltke erlebt, als er als junger Leutnant aus dänischen Diensten kommend in die preußische Armee eintrat.
Schauen wir noch einmal:
„Das Desinteresse mancher Politiker an Sachproblemen der Verteidigung und der Bundeswehr wirkt sich nachteilig aus.“
„Die Struktur und zwangsläufige Schwerfälligkeit des Ministeriums steht im Kontrast zu den Grundforderungen militärischer Führung.“
„Das Auseinanderfallen von Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der Truppenvorgesetzten haben den Eindruck verfestigt, dass die Bundeswehr mehr verwaltet als geführt wird.“
„Die Unsicherheit über die Zukunft und Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit der NATO führten teilweise zur Resignation und vereinzelt zu Forderungen nach nationalen Lösungen. In dieser Lage wirkt es bedrückend, dass weder die Europabewegung Auftrieb erhält, noch das Vaterland als moralische Größe die notwendige Interpretation findet.“
„Diese Aufgabe muss jedem Soldaten vor Augen stehen. Er ist nicht nur zum Abschrecken da, sondern zum Kämpfen, falls die Abschreckung versagt.“
Diese Sätze stammen nicht aus dem Bericht der Wehrbeauftragten, der gerade veröffentlich wurde. Sie sind von Generalleutnant Albert Schnez vom Dezember 1969. Seine „Gedanken zur Verbesserung der inneren Ordnung des Heeres“ hat er niedergeschrieben, da gab es die Helmut-Schmidt-Universität noch nicht.
Zum Schluss bleibt für mich die Frage:
Was für Offiziere wollen die jungen Männer und Frauen sein? Welche Offiziere will die Universität in die Truppe „entlassen“?
Vor allem die Frage, welche Offiziere die jungen Leute sein wollen, halte ich für die wichtigste. Auch da mag sich jeder nach Belieben ein Vorbild suchen:
Clausewitz passt wie immer gut: „Das Wissen muss ein Können werden.“
Wenn junge Menschen die Universität verlassen, wissbegierig bleiben, Neues lernen und entdecken wollen. Dann ist das wissenschaftliche Neugier wie man sie besser nicht verinnerlichen kann.
Oder auch Baudissin: „Der Soldat und insbesondere der Offizier wird nur dann innerhalb und außerhalb der Bundeswehr die notwendige Autorität erlangen, wenn er auch dann zur Wahrheit steht, wenn sie etwas kostet.“
Wahrhaftigkeit ist eine soldatische Tugend. Und die Wissenschaft ist der Wahrheit verpflichtet. Eine gute Mischung also!
„Ich würde die Vorschriften zitieren, aber ich weiß, Sie werden das einfach ignorieren.“ Spock
Nicht die Menschen sind für die Vorschriften da, sondern die Vorschriften für die Menschen. Ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht. Ich denke, das beschreibt einen eher informellen Lernprozess, den man auch an der HSU beobachten kann.
Und letztlich gilt:
„Das ist es, was den Menschen ausmacht. Mehr aus sich zu machen als man ist.“ Jean Luc Picard
Danach sollten wir alle streben.
Schlussgedanke
Admiral Hans-Georg von der Marwitz hat einmal gesagt: Die Universitäten der Bundeswehr schaffen durch ihre Ausbildungs- und Forschungsangebote eine Brücke zwischen Militär und Wissenschaft.“
Die heutige Preisverleihung zeigt, dass Offiziere wissenschaftliche Exzellenz „abliefern“ können. Es zeigt auch, dass die Bundeswehr im Rahmen ihrer vielfältigen Bildungslandschaft gut daran tut, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre Universitäten in der Lehre zu begeistern. Und sie ist berufen, diejenigen unter den angehenden Offizieren, die das Zeug für eine entsprechende wissenschaftliche Laufbahn haben, darin bestärken, diesen Weg zu gehen und das auch in den Streitkräften zu tun, wo dies möglich ist.
Angesichts des dramatischen Wandels in der Welt, multipler Herausforderungen und akuter Krisen braucht die Bundeswehr dringend einen neuen Carl von Clausewitz, einen neuen Helmuth von Moltke oder Gerhard von Scharnhorst.
Oder eben Nina Brandau. Ich gratuliere Ihnen noch einmal von Herzen. Der Universität gratuliere ich, dass sie diese Exzellenz hervorgebracht hat.
Und für die nun folgende Feier wünsche ich gute Stunden. Moltke würde sagen: „Das Zusammenstehen mit den Kameraden erfrischt.“
Wer mag dem widersprechen?